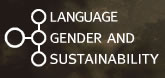| | Wer sind die Tura?
Die Tura leben im gebirgigen Teil des Westens der Elfenbeinküste,
nördlich der Stadt Man, der „Hauptstadt des Westens“, ein bis zwei
Stunden Sandpiste von der Dreiländerecke entfernt, an der sich die
Staatsgrenzen der Elfenbeinküste, Liberias und Guineas treffen,
zwischen dem 7. und 8. Grad nördlicher Breite und dem 7. und 8. Grad
westlicher Länge.
Das Turagebiet ist 650 km von
Abidjan, der wirtschaftlichen Metropole
der Elfenbeinküste entfernt. Seine 52 Dörfer gehören administrativ zum
Departement Biankouma. Der gleichnamige Distrikthauptort, 40 km
nördlich von Man an der nach Bamako, der Hauptstadt Malis, führenden
Transnationalen gelegen, ist Eingangstor zum westlichen und nördlichen
Teil des Turagebiets und zugleich wirtschaftlicher Magnet und
Lebensader des nach Westen orientierten Gebietsteils.
Der Zugang zum südlichen und südöstlichen Teil, in dessen Bereich vor
einigen Jahren die Unterpräfektur Gbonné errichtet wurde, erfolgt in
ähnlicher Weise über Stichstrassen, die von der west-östlich
verlaufenden Transversalen Man-Séguéla her ins Gebirge stossen.
Die Sprache der Tura, das Wεεn (sprich „wεε“), auch Tura (französisch
Toura) genannt, wird von schätzungsweise 60.000
bis 80.000 Menschen als Alltagssprache verwendet. Ein statistisch nicht
klar bestimmbarer Prozentsatz der
turasprachigen Gesamtbevölkerung ist allerdings schon in der zweiten
Generation in der „Diaspora“ ansässig, vor allem in
Abidjan und anderen Städten des Südens, doch bleibt der Zusammenhalt
zwischen Stadt und Dorf identitätsbestimmend und aus wirtschaftlichen
und ideellen Gründen unaufgebbar.
Sprachproben:
He_buys_wine_Il_achète_du_vin.mp3
He_buys_salt_Il_achète_du_sel.mp3
Waveform [Speech Analyzer]
In klimatischer Hinsicht ist das Turagebiet zweigeteilt: der südliche
Teil mit Erhebungen bis zu 1100 Meter gehört zur Regenwaldzone
wie sie für die südliche Hälfte der Elfenbeinküste charakteristisch
ist. Das nördliche Turagebiet, das von Westen nach Osten vom Bafing
, einem Nebenfluss des Sassandra, durchquert wird, ist seinen
physischen Merkmalen nach der Savanne der nördlichen Elfenbeinküste
zuzurechnen. Das Siedlungsgebiet der akephal verfassten Tura
konstituiert sich nicht in erster Linie politisch – die Dorfältesten
sind (ausser dem Ahnenpriester) keiner übergeordneten lokalen Gewalt
Rechenschaft schuldig - , sondern über humanökologische Faktoren -
gemeinsame Ressourcennutzung, gemeinsame Sprache, materielle und
kulturelle Symbiose und gemeinsame Feste usw. - als territoriale
Einheit mit dual ausgeprägter natürlicher Ökologie.
Schon aufgrund seiner Topographie bildet das Turaland eine schwer zugängliche Enklave.
In der Regenzeit sind die meisten Pisten unbefahrbar. Die
für den wirtschaftlichen Aufschwung ungünstige Lage hat sich indessen
in Krisenzeiten als Vorteil erwiesen - so schon Ende des 19.
Jahrhunderts, als der Ansturm der Armeen Samorys an den Berghöhen der
„Monts Toura“ zum Stillstand kam. So auch wieder beim
Ausbruch des Bürgerkriegs am 19. September 2002: Die Tura befinden sich
zwar geographisch gesehen im Herzen des Konfliktgebiets,
sind aber dank der Entlegenheit ihres Wohngebiets von unmittelbaren
Kampfhandlungen weitgehend verschont geblieben. In den Monaten nach
Ausbruch der Kämpfe im Westen wurde überdies zahlreichen Vertriebenen
ohne Rücksicht auf politische und ethnische Zugehörigkeit in den
Dörfern Gastrecht gewährt, ebenso vielen Tura aus der städtischen
Diaspora.
Die bereits vor dem Krieg als Folge des Zerfalls der Weltmarktpreise
für Kaffee prekär gewordene wirtschaftliche Lage der Tura hat sich
durch das andauernde Bürgerkriegspatt nochmals radikal verschlechtert.
Dies hat auch Auswirkungen auf das ökologische Gleichgewicht. Besonders
deutlich wird das Zusammenspiel von wirtschaftlicher Bedrängnis und
Umweltzerstörung am Beispiel der massenweisen Herstellung von Besen aus
jungen Ölpalmen - dem angeblich einzigen Weg, um nach dem Zusammenbruch
des Kaffee- und Kakaoexports und dem Verlust der Kaufkraft auf den
lokalen Märkten zu ein wenig Geld zu dem für die Alltagsbedürfnisse
Notwendigen zu kommen, um den Preis der Zerstörung einer einmaligen
natürlichen Ressource.
Können die von jeher bestehende wirtschaftliche Randlage und die durch die aktuellen Ereignisse
verstärkte Notlage der Tura im Endeffekt in einen Entwicklungssprung
verwandelt werden? Das Projekt LaGSus-Tura geht hoffnungsvollen, im
lokalen Denken verankerten Gegenstrategien nach, die auch für andere
Rand-, Rückzugs- und Krisengebiete von Interesse sein
könnten.
Wichtige Entscheidungen, ob sie den Clan, das Dorf
oder ein Entwicklungsprojekt betreffen, fallen in der
Palaverhütte. Sie ist das geistige Zentrum des Lebens, an dem
das lokale Wissen sich mit importiertem innovativem Wissen zu
zukunftsweisenden Lösungen verbinden kann. An der Palaverhütte vorbei
führt auch heute noch kein Weg zur Nachhaltigkeit.
|